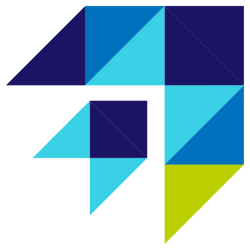Verantwortung in Organisationen
Verantwortung übernehmen: die Kunst des gemeinsamen Handelns
Verantwortung ist eines dieser großen Schlagworte in Organisationen. Fast jede Führungskraft wünscht sich mehr davon, viele Mitarbeitende fordern sie – und doch erleben wir täglich das Gegenteil: Unklare Zuständigkeiten, Entscheidungsblockaden oder das berühmte „Das ist nicht mein Job“. Warum tun sich so viele Unternehmen mit Verantwortung schwer – und wie lässt sie sich gezielt fördern?
Was ist Verantwortung eigentlich?
Im Kern bedeutet Verantwortung, für ein Handeln oder Unterlassen einzustehen. Doch in Organisationen ist sie vielschichtiger. Schmid und Messmer (2004) unterscheiden vier Dimensionen, die Verantwortung konkret machen.
Auf persönlicher Ebene stehen
Wollen – die innere Motivation und Bereitschaft, eine Aufgabe zu übernehmen.
Können – die fachlichen und persönlichen Fähigkeiten, Verantwortung tatsächlich auszuüben.
Auf organisationaler Ebene sind es
Dürfen – die formale Legitimation und Entscheidungsbefugnis, die notwendig ist.
Müssen – die Verpflichtung durch die Rolle oder das System.
👉 Erst wenn alle vier Dimensionen erfüllt sind, kann echte Verantwortung entstehen.
Ein Beispiel: Eine Teamleiterin „muss“ ein Projekt steuern (Müssen) und „darf“ Entscheidungen treffen (Dürfen). Wenn sie jedoch nicht die nötigen Kompetenzen (Können) oder schlicht keine Motivation (Wollen) hat, bleibt Verantwortung ein leeres Konstrukt.
Das zeigt: Verantwortung ist kein statisches Etikett, sondern ein dynamisches Zusammenspiel zwischen Individuum, Rolle und Organisation.
Warum sind klare Verantwortlichkeiten so wichtig?
Orientierung und Effizienz – Mitarbeitende wissen, worauf sie sich fokussieren sollen, und Aufgaben gehen nicht verloren.
Schnellere Entscheidungen – klare Entscheidungswege verhindern endlose Abstimmungsschleifen.
Vertrauen & psychologische Sicherheit – weniger Konflikte und Schuldzuweisungen.
Unternehmensweite Resilienz – Organisationen, die Verantwortung verteilen und verstehen, sind krisenfester.
Studien zeigen: Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten zählen zu den größten Ursachen für Konflikte und Ineffizienz in Teams (Katzenbach & Smith, 2005).
Warum scheitern so viele Unternehmen an klarer Verantwortung?
Trotz guter Absichten stolpern viele Organisationen immer wieder über dieselben Muster, wenn es um Verantwortungsübernahme geht. Die folgenden Faktoren spielen dabei eine zentrale Rolle:
1. Komplexität & Silodenken
In vielen Unternehmen sind Prozesse hochkomplex, Abteilungen stark voneinander abgegrenzt. Dadurch entstehen Überschneidungen und Lücken: Wer ist nun wirklich zuständig? Das Ergebnis ist oft ein „Ping-Pong-Spiel“ zwischen Abteilungen – Aufgaben werden hin- und hergeschoben, bis niemand mehr so recht weiß, wer die Verantwortung trägt. Verantwortung wird so zur „heißen Kartoffel“, die niemand behalten möchte.
2. Mangel an Klarheit
Viele Aufgabenbeschreibungen sind zu allgemein, überfrachtet oder schlicht nicht mehr aktuell. In dynamischen Märkten verändern sich Anforderungen ständig, doch Stellenprofile und Verantwortlichkeitsbereiche werden nicht angepasst. Mitarbeitende wissen zwar, was sie tun sollen, aber nicht, wofür sie letztlich verantwortlich sind. Das führt zu Unsicherheit und im schlimmsten Fall zu Stillstand.
3. Führungskultur
Führung spielt eine Schlüsselrolle. In Organisationen, die stark von Micromanagement geprägt sind, wird Verantwortung oft gar nicht erst zugelassen. Wenn Führungskräfte jede Entscheidung kontrollieren oder Ergebnisse ständig korrigieren, entsteht bei Mitarbeitenden der Eindruck: „Egal, was ich tue – am Ende entscheidet sowieso jemand anderes.“ Das hemmt Eigeninitiative und verhindert Verantwortungsübernahme.
4. Angst vor Fehlern
Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen – und damit das Risiko einzugehen, Fehler zu machen. In Unternehmen ohne gelebte Fehlerkultur bleibt Verantwortung deshalb oft auf der Strecke. Mitarbeitende sichern sich lieber ab, vertagen Entscheidungen oder spielen sie zurück nach oben. Anstatt aus Fehlern zu lernen, entstehen so lähmende Schuldzuweisungen.
5. Agilität ohne Fundament
Viele Organisationen haben in den letzten Jahren agile Methoden eingeführt – Scrum, Kanban, Daily Stand-ups. Doch häufig wurden die Strukturen nicht mit angepasst: Teams sollen selbstorganisiert arbeiten, haben aber keine echte Entscheidungsbefugnis oder nur begrenzte Ressourcen. Das führt zu Frust: Formal tragen Mitarbeitende Verantwortung, faktisch bleiben sie abhängig von Hierarchie-Entscheidungen. Agilität wird so zur Fassade ohne Substanz.
✨ Ergebnis: Verantwortung scheitert nicht am guten Willen, sondern an Strukturen, Kultur und Klarheit. Erst wenn Organisationen bewusst an diesen Stellschrauben drehen, kann echte Verantwortungsübernahme gelingen.
Verantwortung im Unternehmen etablieren: Ein Praxisleitfaden
Viele Unternehmen wünschen sich mehr Verantwortungsübernahme – doch häufig bleibt es bei Appellen. Echte Verantwortung entsteht erst, wenn Strukturen, Kultur und Dialog zusammenspielen. Der folgende Leitfaden zeigt, wie Unternehmen Verantwortung erfolgreich fördern können.
1. Verantwortung ganzheitlich prüfen
Schmid & Messmer (2004) beschreiben vier Dimensionen, die erfüllt sein müssen, damit Verantwortung wirksam übernommen wird:
Wollen: Mitarbeitende müssen motiviert sein, die Aufgabe zu übernehmen. Führungskräfte können dies fördern, indem sie den Sinn der Aufgabe verdeutlichen und den Beitrag zum größeren Ganzen aufzeigen.
Können: Fachliche und soziale Kompetenzen müssen vorhanden sein. Schulungen, Coaching oder Mentoring helfen, Fähigkeiten gezielt aufzubauen.
Dürfen: Mitarbeitende benötigen die formale Befugnis, Entscheidungen zu treffen. Rollenprofile, Delegationsvereinbarungen oder Entscheidungsrechte müssen klar definiert sein.
Müssen: Die Aufgabe muss Teil der Rolle und der organisatorischen Erwartungen sein. Rollenbeschreibungen und regelmäßige Absprachen sorgen dafür, dass Pflichten realistisch bleiben.
Praxis-Tipp: Vor Aufgabenübergaben oder Projekten ein kurzes Check-in durchführen: Wollen, Können, Dürfen, Müssen – wo bestehen Lücken und wie können wir sie schließen?
2. Zuständigkeiten sichtbar machen
Unklare Rollen und Zuständigkeiten sind ein Hauptgrund, warum Verantwortung scheitert.
RACI-Matrix: Wer ist Responsible, Accountable, Consulted, Informed?
Verantwortungslandkarten: Visualisieren, wer wofür zuständig ist, macht Lücken und Überschneidungen sichtbar.
Team-Canvas / Rollen-Canvas: Rollen klar definieren – inklusive Zweck, Aufgaben, Entscheidungsbefugnis und Schnittstellen.
Praxis-Tipp: Mindestens einmal pro Quartal gemeinsam prüfen: Sind die Verantwortlichkeiten noch aktuell?
3. Verantwortungsdialog fördern
Verantwortung entsteht im Austausch, nicht per Dekret.
Regelmäßige Dialoge: Mitarbeitergespräche, Team-Reviews oder Retrospektiven nutzen, um Verantwortungsbereiche zu klären.
Fragen für den Dialog:
Wo fühle ich mich verantwortlich – und wo nicht?
Welche Entscheidungen kann ich heute nicht treffen, obwohl ich sollte?
Welche Unterstützung oder Ressourcen brauche ich?
Feedback-Schleifen: Ergebnisse nicht nur kontrollieren, sondern gemeinsam reflektieren, was funktioniert und wo Anpassungen nötig sind.
Praxis-Tipp: Dialoge dokumentieren – sichtbar für alle Beteiligten – um Verantwortung nachvollziehbar zu machen.
4. Verantwortungskultur verankern
Strukturen allein genügen nicht. Eine Kultur, die Verantwortung wertschätzt und fördert, ist entscheidend.
Fehlerfreundlichkeit: Verantwortung wird nur übernommen, wenn Mitarbeitende wissen, dass Fehler als Lernchance gelten.
Anerkennung: Eigenverantwortliches Handeln sichtbar würdigen – nicht nur Ergebnisse feiern.
Vorbildfunktion: Führungskräfte zeigen, wie Verantwortung übernommen, delegiert und getragen wird.
Transparenz: Entscheidungswege und Zuständigkeiten offen kommunizieren, z. B. durch digitale Boards oder Team-Meetings.
Praxis-Tipp: Kleine Erfolge sichtbar machen: „Hier hat unser Team eigenverantwortlich entschieden – und das Ergebnis war positiv.“
5. Schrittweise Umsetzung für traditionelle Unternehmen
Traditionelle, hierarchisch geprägte Unternehmen profitieren von einem schrittweisen Ansatz:
Pilot starten: Ein Team oder Projekt bewusst auswählen, um Verantwortung neu zu definieren.
Dialog führen: Verantwortungsbereiche und Entscheidungsrechte gemeinsam klären.
Erfahrungen auswerten: Was funktioniert, wo gibt es Blockaden?
Skalieren: Erfolgreiche Prinzipien auf andere Teams übertragen.
Praxis-Tipp: Führungskräfte coachen und einbinden – Verantwortung kann nur dann wachsen, wenn sie im gesamten System unterstützt wird.
✨ Kernaussage: Verantwortung entsteht dort, wo Struktur, Dialog und Kultur zusammenspielen. Unternehmen, die dies konsequent umsetzen, profitieren von mehr Eigeninitiative, schnelleren Entscheidungen und resilienteren Teams.
Fazit
Verantwortung ist das Rückgrat jeder Organisation – aber sie entsteht nur, wenn Motivation, Kompetenz, Befugnis und Verpflichtung zusammenkommen. Gerade traditionelle Unternehmen können viel gewinnen, wenn sie Verantwortung nicht nur zuweisen, sondern als lebendigen Dialog zwischen Menschen und Systemen verstehen.
Wer es schafft, klare Verantwortlichkeiten zu definieren und gleichzeitig Eigenverantwortung zu fördern, macht die Organisation schneller, resilienter und attraktiver für Mitarbeitende.
Dieser Text wurde in Teilen von KI generiert und beruft sich auf folgende Quellen.
Schmid, B., & Messmer, A. (2004). Verantwortung. Leadership und Organisation aus systemischer Sicht. ZKM – Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung, 22(1).
Edmondson, A. C. (2019). The Fearless Organization. Wiley.
Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2005). The Wisdom of Teams. Harper Business.
Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The Social Psychology of Organizations. Wiley.
Luhmann, N. (1997). Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp.